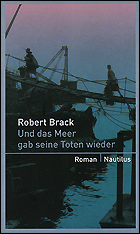leseprobeUnd das Meer gab seine Toten wieder
Das Buch erschien im Juni 2008 in der Edition Nautilus. Zurück zu den [ büchern ] [ Jennifer Stevenson ermittelt ]: Erfahren Sie mehr über den Inhalt [ Die Geschichte eines Hamburger Polizeiskandals ]: Interview mit Robert Brack [ Die Toten von Pellworm ]: Robert Brack über die historischen Hintergründe
PROLOG: VERWEHTE GESTALTEN
Wie schön wäre es, hier mit dir zu sterben? Unter dem weiten Himmel, am Ufer des endlosen Meeres. Wer würde uns holen? Die Wellen? Wer sonst? Die Erde tut sich nicht von allein auf. Und hier, in diesem Teil der Welt, bietet sie wahrhaftig keine zuverlässige Heimstatt. Allzu gierig nagen die Fluten an der mürben Scholle. Und der Himmel? Wer sollte von dort herabsteigen? Nur Möwen. Jemand sprach von Möwen. »Die sind wie Geier. Haben Sie mal eine Leiche gesehen, über die sich die Möwen hergemacht haben? Wie die aussieht? Erst gehen sie an die Augen ...« Mich schauderte, als ich das hörte. Haben die beiden daran gedacht, als sie sich auf das grüne Bett der Salzwiese jenseits des schützenden Deichs legten? Und wir? Wir wollen doch nicht als Möwenfraß enden, oder? Und überhaupt, warum denn sterben? Es wäre an der Zeit zu leben! Wenn du wolltest ... nein, wenn ich wollte ... Es ist nicht der rechte Ort an so etwas zu denken. Es ist viel zu kalt. Eisige Böen peitschen die kahlen Äste. Mich friert, meine Finger werden steif. Und doch würde ich dir diese Gedanken gern im Brief schicken. Wartest du denn überhaupt auf eine Nachricht von mir?
»Das reife Feld, wer heimst es ein,
So schrieb es der Dichter dieser Insel. Und so haben es die beiden Unglücklichen, die hier den Tod fanden, gelesen. Es ist ihr Buch. Die Wirtin aus der Pension, in der sie ihre letzte Nacht verbrachten, hat es mir gegeben. »Mehr haben sie nicht zurückgelassen. Sind nur Gedichte.« Ein kleines schmales Büchlein mit einem Blumenornament auf dem Einband. Bemalte Pappe, nichts weiter. Dünne bedruckte Seiten. Eine Widmung. Bemerkenswert daran ist, dass es zwei Widmungen sind, in zwei verschiedenen Handschriften: »Für Thesy!« und »Für Maria!«, geschrieben mit derselben Tinte, derselben Feder, wie es scheint. Das erste Gedicht trägt den Titel: »Die zwei Sensen«:
»Und all die Blumen fallen mit,
Warum haben sie das Buch nicht mitgenommen? Sie haben doch sonst alles wohl geordnet hinterlassen, sogar sich selbst – nebeneinander liegend auf dem Vorland, ihr Handgepäck ordentlich abgestellt, zwei weiße Tücher über die Gesichter gebreitet. Wegen der Möwen? Es ist alles mehrfach beschrieben worden, aber niemand hat davon berichtet, ob sie sich an den Händen hielten. Gift, ja Gift, davon sprach man, auch von einer Pistole, vom Ertrinken, von Fesseln, aber nicht von den Händen, und ob sie während der letzten Sekunden einander festhielten. Haben sie die Grenze gemeinsam, im gleichen Moment überschritten, oder ging Thesy voran, so wie sie es immer tat, und zog Maria mit sich? Und haben sie an die Fluten gedacht, an den unbändigen Sturm und die entfesselte Naturgewalt, die zwei Tage darauf die Insel überfiel? Bestimmt nicht. Es war ein strahlender Sommertag, als sie am Morgen fort gingen. Das Unwetter brach erst später los, »rauschende, schwarze, langmähnige Wogen kamen wie rasende Rosse geflogen.« Wäre es nicht besser gewesen, das Meer hätte sie verschlungen? Jetzt liegen sie in der Erde, auf demselben Friedhof, nur leider nicht nebeneinander. Im Tod getrennt. Das ist traurig.
Aber möglich wäre doch, dass alles ganz anders geschehen ist. Dieser Gedanke kommt mir immer wieder. Wie können zwei Menschen so lange an einer Stelle gleich hinter dem Deich liegen, ohne dass jemand sie bemerkt und etwas unternimmt? Wer sonnt sich denn tagelang in gleicher Pose am selben Ort? Vollständig bekleidet mitten im Sommer in der Julihitze? Und später, als der Sturm losbrach, hat da niemand an sie gedacht, an die beiden Frauen, die ihre Pension verlassen hatten, an den Strand gingen und nicht mehr zurückkamen? Was, wenn sie gar nicht die ganze Zeit dort gelegen hätten? Wenn jemand sie weggeholt und später wieder hingebracht hat? Wer und warum, fragst du? Gibt es nicht genügend dunkle Gestalten in dieser Geschichte? Bin ich nicht auf der Flucht vor ihnen? Ach, ich wünschte, du wärst jetzt hier. Dann müsste ich mich nicht fürchten. Vor ihm. Womöglich ist der, der mich sucht, schon auf der Insel. Wie soll ich mich vor ihm in Sicherheit bringen? Das Schiff fährt erst morgen früh.Ich wage gar nicht, mir auszudenken, was geschieht, wenn er mit mir den Dampfer betritt. Jetzt im Winter kommen kaum Besucher auf die Insel. Es ist durchaus möglich, dass niemand außer uns zum Festland aufbricht. Wir wären die einzigen Passagiere an Bord! Oder was soll ich tun, wenn er mir im Hotel auflauert? Er kann ganz ruhig im Gastraum sitzen, Bier trinken und warten, bis ich herein komme, um mir meinen Schlüssel zu holen. Die Zimmernummer hat er vielleicht schon erfragt ... Ich werde nicht öffnen, wenn es klopft! Und wenn mir etwas geschieht? Dann musst du weitermachen! Klara, ich setze all meine Hoffnung auf dich, siehst du? Wenn ich mich nicht geniere, werde ich diese Zeilen in einen Umschlag stecken und am Postamt abgeben. Dann erfährst du alles. Dort hinten kommen zwei verwehte Gestalten über den Deich, der frostige Wind zerrt an ihren Mänteln ... Meine Hände sind starr, ich kann kaum noch schreiben ...
ERSTER TEIL: IM RÄDERWERK
Kapitel 1
Vor allem roch es nach verbrannter Kohle. Überall Rauch, vermischt mit Nebel, Eisbrocken trieben im schwarzen Wasser, Schneeflocken wirbelten durch die Luft. Durchdringendes Sirenengeheul, doch die Stadt im Dunst blieb unbeeindruckt von unserer Ankunft. Was bildeten wir uns auch ein? Ein zweiter Blick auf den Hafen zeigte uns die massigen Umrisse viel größerer Schiffe. Zwei Schlepper halfen beim Wenden zwischen Frachtern, Fähren und Barkassen. Wir fügten uns bescheiden ein zwischen zwei Ozeanriesen ein und machten an der Überseebrücke fest. Willkommen in Hamburg. Eine Ankunft im Morgengrauen. Allein in der Fremde. Eine Mission. Kein Grund, pathetisch zu werden, Jenny. Es war viel zu frostig für große Gefühle und dein Koffer zu schwer für tiefschürfende Gedanken. »Siehst du«, sagte die kleine Anna, die neben mir über die Reling spähte, »jetzt sind wir nicht mehr grün im Gesicht.« »Was für ein Glück.« »Ja, grau siehst du viel besser aus. Tschüss, ich muss jetzt gehen.« Ein flüchtiger Händedruck, ein angedeuteter Knicks und weg war sie. Ein Blick über die Bordwand. Die ersten Passagiere betraten vorsichtig die Gangway. Es sind immer die Ängstlichen, die zuerst das Schiff verlassen. Ich griff nach dem Koffer und ging von Deck. Draußen auf dem Ponton fühlte ich mich klein als Teil des Auflaufs winziger Menschen neben den hoch aufragenden schwimmenden Stahlwänden. Ein langer eiserner Steg führte an Land. »... man erwartet Sie gegenüber der Brücke ... am Zeitungsstand unter der Hochbahn ... « Automobile fuhren vor und nahmen die wohlhabenden Reisenden auf. Jenseits der Hochbahn eine Tramhaltestelle, dahinter reckten sich mehrstöckige Häuser mit spitzen Giebeln in die Höhe. Ich stellte den Koffer ab, schlug meinen Mantelkragen hoch und schaute mich um. Die Frau im Zeitungsstand rauchte eine Pfeife und musterte mich argwöhnisch. Über mir rumpelten Waggons über die Eisenbrücke. Ein Mann trat auf mich zu, streckte die Hand aus. Er trug nicht mal einen Mantel, nur ein armseliges Jackett, darunter ein schmutziges Baumwollhemd, die Hosen so kurz, dass man die nackten Beine sah.»Es tut mir leid, ich habe kein deutsches Geld.« Er stolperte vorbei, mit unbewegtem Gesicht. Einer von sechs Millionen Arbeitslosen in Deutschland an diesem Tag, dem 29. Februar, der das Jahr des Elends 1932 um vierundzwanzig Stunden verlängerte. Ich erkannte die Frau an ihrem Hut. Natürlich trug sie keine Uniform, ihre Dienststelle war aufgelöst worden, es gab keine weiblichen Streifenbeamten mehr, aber der Hut erinnerte mich an meine Kolleginnen in England. Einen solchen Hut trägt eine Frau sonst nicht. »Good morning«, sagte sie unbeholfen. »My name is Berta Winter.« »Guten Morgen, Frau Winter. Ich bin Jennifer Stevenson von der International Policewomen's Association. Ich freue mich, Sie kennen zu lernen.« Wir schüttelten uns die Hand. »Oh, Sie sprechen Deutsch«, stellte sie erleichtert fest. »Ein bisschen.« »Ich bin die Einzige bei uns, die etwas Englisch beherrscht ... deshalb hat man mich ... Lernt man denn bei der englischen Polizei Fremdsprachen?« »Nein. Eine Tante hat es mir beigebracht. Sie kam aus Hamburg.« »Ach, dann sind Sie sozusagen eine Landsmännin?« »Nein, nur die Tante.« »Ach so.« Sie schaute auf meinen Koffer, offenbar unschlüssig, ob sie ihn tragen sollte. »Wir könnten die Straßenbahn nehmen, nur zwei Stationen ... oder ...« »Zu Fuß wäre mir angenehm. Ich kann etwas Bewegung gebrauchen.« Sie trat auf den Koffer zu. »Soll ich den ...?« »Nein, nein, ich glaube, das schaffe ich schon.« Ich hob mein einziges Gepäckstück an, um zu zeigen, dass es mir keine Mühe bereitete. Sicherlich war ich die Stärkere von uns beiden, wenn auch etwas kleiner als meine deutsche Kollegin, die schmal und schlank gebaut war, weshalb die schweren Schnürstiefel an ihren Füßen und der plumpe Hut nicht recht zu ihr passen wollten. Berta Winter drehte sich um. Mein Blick fiel auf die Zeitungsverkäuferin. Sollte ich mich verabschieden? Immerhin hatte sie mich die ganze Zeit unverholen angestarrt. Ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen, sagte sie: »English papers heb wi ook.« Und stieß eine Rauchwolke aus. Ich dankte mit einem Kopfnicken und folgte meiner Gastgeberin über die Fahrbahn, durch größere Straßen und verwinkelte Gassen, bis wir vor einem schmalen vierstöckigen Fachwerkhaus standen. »Oben unterm Dachboden«, sagte Berta entschuldigend. »Groß ist es leider nicht. Aber ich kann uns Kaffee machen. Aus echten Bohnen.« »Das gefällt mir gut.« Über eine steile Stiege gelangten wir in ihre Wohnung. Einige Wände hatten Dachschrägen. »Es ist ein Zimmer zuviel da ... meine Mutter ist im letzten Jahr verstorben ...« Sie zeigte mir eine schlicht eingerichtete Küche, ein Wohnzimmer, das sie erst aufschließen musste, ein Schlafzimmer mit einem düster wirkenden mächtigen Doppelbett und eine Kammer, in der kaum mehr als Tisch, Stuhl, Bett und Kommode Platz fanden. Es ging nach hinten hinaus und hatte nur ein sehr kleines Fenster. An der sonst kahlen Wand ein Bild mit Blumen. Über dem Tisch ein schmales Regal mit Büchern. »Eigentlich war das immer mein Zimmer ... aber jetzt ...« Ich stellte meinen Koffer ab. »Es ist schön.« »Sicher etwas eng.« Ich trat ans Fenster. Unten im Hinterhof waren lange Bretter aufgeschichtet, Arbeitsgeräte standen herum. Ich hatte das Firmenschild einer Tischlerei am Nebenhaus bemerkt. »Wenn die da unten zu laut hämmern, muss man schreien, dann kuschen sie schon«, sagte Berta und hob unvermittelt meinen Koffer hoch, um ihn auf das Bett zu werfen. »Danke«, sagte ich erstaunt. »Ich mach uns mal einen Kaffee. Die Toilette ist eine halbe Treppe tiefer. Der Schlüssel liegt oben auf dem Türrahmen, damit sich die Kinder nicht andauernd einschließen ...« »Gut, vielen Dank.« Der Kaffee, den sie mir dann in ihrer kleinen Küche servierte, war bestimmt der Beste, den ich je getrunken hatte. Leider blieb es bei diesem einen Mal. Wir unterhielten uns über dies und das. Ich erzählte ein bisschen von Tante Elsi, die von meinem Onkel Jack, einem schottischen Matrosen, nach Glasgow gebracht worden war. Er hatte versprochen, mit ihr nach Amerika auszuwandern. Aber dann sind sie in Schottland geblieben. Er trank und sie »verdorrte so langsam«, wie sie sich ausdrückte. Dass sie vom »Hamburger Berg« stammte, wie sie St. Pauli immer nannte, verschwieg ich Berta, obwohl ich annehmen durfte, dass wir als Kolleginnen keine Vorurteile kannten. »Für Tante Elsi ist Hamburg die schönste Stadt der Welt. Und Glasgow die Hölle«, erzählte ich. »Warum kommt sie dann nicht zurück?« »Sie ist verheiratet und mittellos ...« »Sklaverei«, sagte Berta. »Sie hat mich erzogen, nachdem meine Mutter starb. Seit ich in London bin, schicke ich ihr Briefe. Aber es kommt nie einer zurück.« »Vielleicht hätten Sie sie mitnehmen sollen.« Du hast es nicht bemerkt, Berta, aber was du da gesagt hattest, rührte mich sehr. Warum bin ich nie auf diesen Gedanken gekommen? Nach einer Weile kamen wir endlich auf den Grund meiner Reise zu sprechen. »Es ist doch längst zu spät«, sagte Berta. »Unsere Dienststelle ist aufgelöst.« »Mag sein, aber warum?« Sie legte das Messer beiseite, mit dem sie sich ein Butterbrot geschmiert hatte. »Warum? Aber wisst ihr das in England denn noch nicht? Zwei unserer besten Polizistinnen haben ... sind ums Leben gekommen!« »Selbstmord, heißt es.« »Dann wisst ihr es also doch.« »Ja, sicher, aber warum wird eine ganze Dienststelle aufgelöst, wenn zwei Beamtinnen sich umbringen?« »Weil es nicht mehr ging! Unsere Chefin steht doch unter Anklage! Sie darf die Abteilung nicht mehr leiten. Und wer sollte es sonst tun? Thesy, also Therese Dopfer war ihre Stellvertreterin, aber sie ist ja nun tot. Erst hat der Forster von der Sitte die Leitung übernommen. Aber dann wurden alle auf verschiedene Abteilungen verteilt.« »Das ist es ja eben, was uns wundert. Josephine Erkens, die international anerkannte Expertin, die Bahnbrechendes auf dem Gebiet der weiblichen Kriminalpolizei geleistet hat, wurde ihres Amtes enthoben und einem Disziplinarverfahren unterzogen. Warum?« Berta sah mich unglücklich an, vielleicht war ich zu aufbrausend geworden. »Das ... das weiß ich nicht.« »Macht man sie für den Tod ihrer Untergebenen verantwortlich?« »Ja ... nein ... ich weiß nicht. Sie hatte doch immer Scherereien mit den Vorgesetzten.« »Nur weil eine Beamtin Konflikte mit ihren Vorgesetzten hat, wird doch nicht eine ganze Abteilung aufgelöst!«Berta blickte verlegen um sich, schaute durchs Fenster in den stahlgrauen Himmel. Aus Schornsteinen quoll gelber Qualm und stieg träge nach oben. Sie zog ein Taschentuch aus dem Ärmel ihres dunkelblauen Kleids, schnäuzte und tupfte sich die Augenwinkel. »Es ist alles so schrecklich schiefgelaufen. Dabei hatte es wunderbar angefangen.« Sie seufzte. »Es war, wie wenn man unter Freunden arbeitet. Zuerst waren wir ganz wenige, nur fünf Beamte, Frau Erkens und Thesy und die Maria Fischer und zwei Männer. Und wir Angestellten – ich habe als Schreibkraft angefangen. Wir hatten die schönste Dienststelle im ganzen Stadthaus. Blumen am Fenster, Blumen auf den Schreibtischen, in der Ecke Kinderspielzeug, Bilderbücher, Stofftiere, Puppen. Wenn Frauen mit Kindern kamen, haben wir uns gekümmert und ihnen was zum Spielen gegeben. Wir haben nicht nur Anzeigen aufgenommen oder Protokolle geführt, wir haben junge Mädchen beraten und Frauen in Not geholfen. Es ging ja nicht nur um Verbrechen ... Jeder konnte sich mit jedem besprechen, auch mit den männlichen Beamten. Es herrschte ein großer Gemeinschaftsgeist. Einmal in der Woche gab es großen Kaffeeklatsch.« Sie lächelte wehmütig. »Und Frau Erkens und Thesy Dopfer waren ein Herz und eine Seele. ›Mein Goldschatz‹ hat Frau Erkens immer zu ihr gesagt. Aber irgendwann war dann alles anders. Da sind sie dann aufeinander losgegangen wie die Furien.« »Aber das kann doch nicht über Nacht gekommen sein.« Sie zuckte mit den Schultern. »Es ist einfach passiert und jetzt ist es eben vorbei. Und ganz bestimmt ist Frau Erkens nicht unschuldig an alledem.« »Ich habe Frau Erkens in London auf einer Tagung kennen gelernt. Dort machte sie einen überaus liebenswerten, ernsthaften und kompetenten Eindruck. Sie hat viel Beifall bekommen.« »Dann hast du dich eben auch von ihr blenden lassen!«, stieß Berta plötzlich wütend hervor und hielt sich vor Schreck die Hand vor den Mund. »Entschuldigen Sie bitte.« »Ist schon gut. Aber ich glaube, wir können ruhig beim Du bleiben.« Berta lächelte zaghaft. »Nur unter einer Bedingung: Ich muss nichts mehr zu dieser furchtbaren Sache aussagen. Die anderen wissen auch viel besser Bescheid.« »Ich darf doch gar keine Aussagen offiziell aufnehmen. Aber ich habe die Absicht, Fragen zu stellen, und wäre dir sehr dankbar, wenn du mich jetzt zur Polizeizentrale bringen könntest.« Ich stand auf, nun hatte ich es eilig. Mein Magen knurrte auch nach zwei Butterbroten noch, zu Hause war ich ein anderes Frühstück gewöhnt. Möglicherweise kamen wir auf dem Weg an einer Schlachterei vorbei, wo die berühmten deutschen Würste verkauft wurden. »Vielleicht erwartet man mich ja schon«, fügte ich hinzu, um mein Hungergefühl zu kaschieren. »Das glaube ich eher nicht«, sagte Berta.
zurück zu den [ büchern ] |